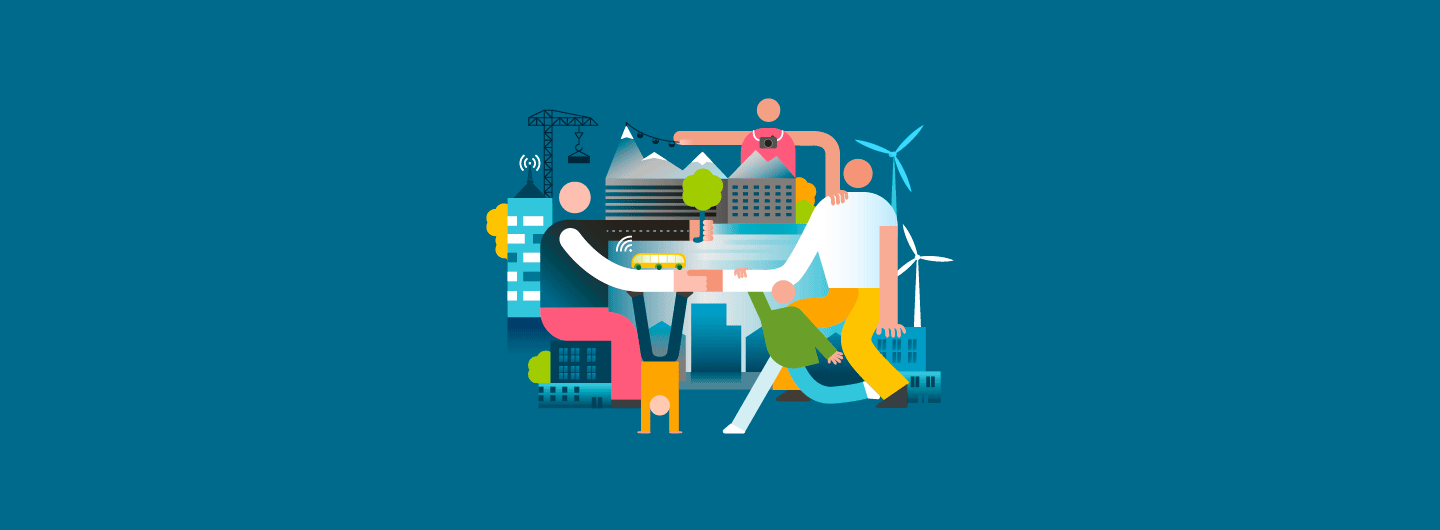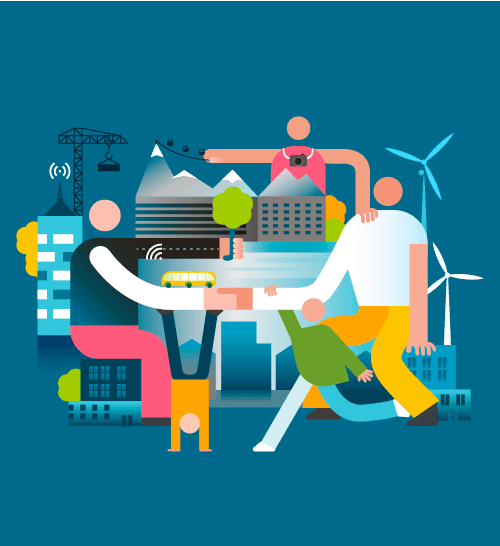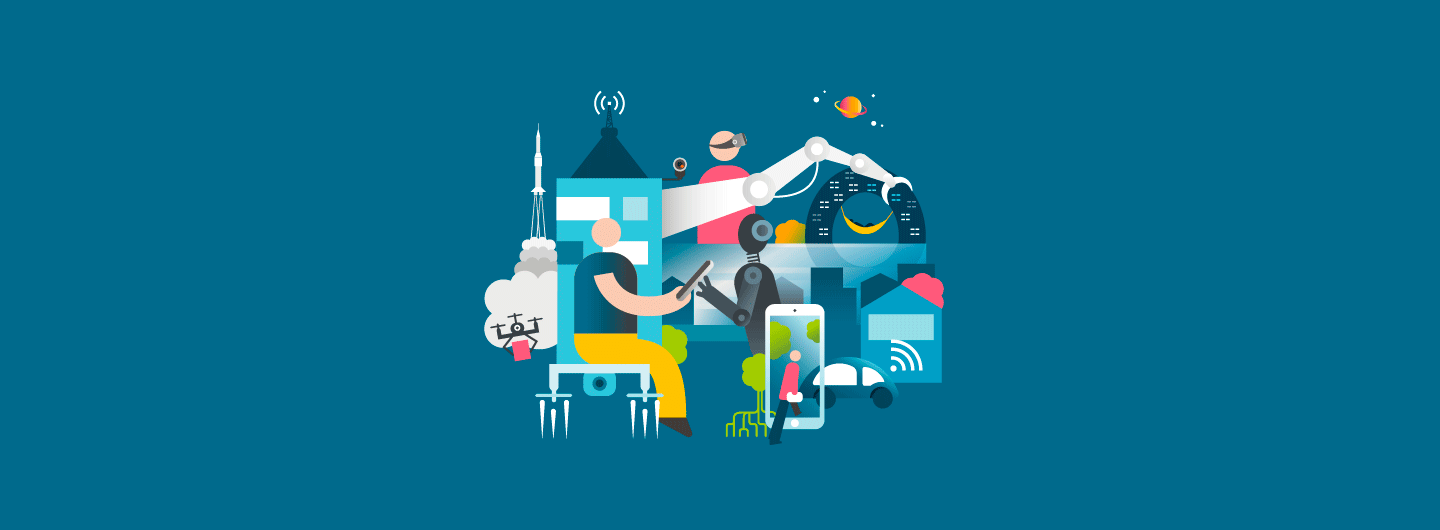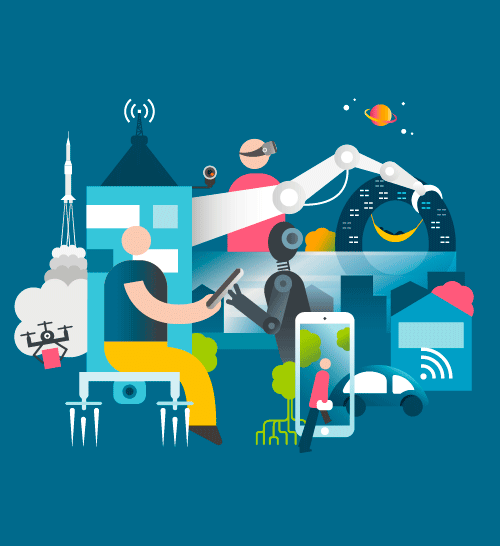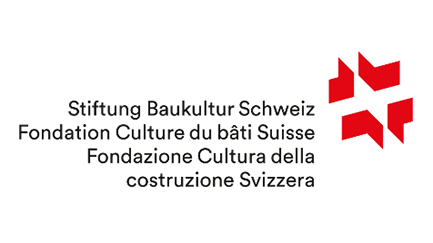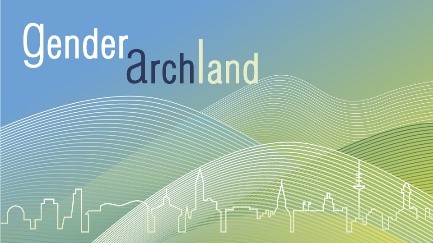Im Interdisziplinären Themencluster (ITC) «Raum & Gesellschaft» wurde seit 2018 untersucht, wie den räumlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts durch interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Raumentwicklung begegnet werden kann.
Im Rahmen der Strategieperiode 2024-2027 der Hochschule Luzern wurde der ITC in das Interdisziplinäre Netzwerk (IDN) «Raum & Gesellschaft» überführt.
Der gesellschaftliche Wandel hat grosse Auswirkungen auf unser Zusammenleben. Daraus ergeben sich Herausforderungen wie Nutzungskonflikte, ein verstärkter Standortwettbewerb, dauerhafte Benachteiligung bestimmter Regionen, Versorgungsdefizite oder die Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Um diesen begegnen zu können, braucht es technische, architektonische und wirtschaftliche Ansätze, aber auch sozialwissenschaftliche, kulturelle und digitale Lösungen. Diese lassen sich nur mit interdisziplinären Ansätzen finden. Hier setzt der interdisziplinäre Themencluster ITC «Raum & Gesellschaft» an. Er verfolgt seit 2018 das Ziel einer integralen Raumentwicklung mit Lösungen, welche die Lebensqualität verbessern und das Zusammenleben stärken. Ein schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen und der Umwelt ist dabei zentral.
«Die Fokusthemen des ITC «Raum & Gesellschaft» bewegen sich an der Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Wirtschaft. In beiden Feldern verändern sich die Bedürfnisse rasch. Um aktuelle Herausforderungen in der Raumentwicklung zu meistern, entwickelt die HSLU massgeschneiderte Forschungsprojekte und innovative Aus- und Weiterbildungsformate.»
Dr. Anita Grams, SBB Unternehmensentwicklung, Expertin integrierte Mobilitäts- und Raumplanung
Im Fokus steht eine umfassende sozialräumliche Betrachtung, basierend auf den gesellschaftlichen, gebauten Strukturen und den Menschen und ihren alltäglichen Handlungen. Dieses Raumverständnis eröffnet ein erhebliches Innovationspotenzial für die bestehenden Herausforderungen in der Raumentwicklung. Dabei bildet die materielle Dimension von Raum die physische Seite räumlicher Praktiken ab. Die symbolische Dimension von Raum umfasst historische, ökonomische, kulturelle Zuschreibungen und Bedeutungen. Die dritte Dimension ist der erlebte und gelebte Raum, wie er von Menschen alltäglich wahrgenommen und realisiert wird. Mithilfe dieses Raumverständnisses ist es möglich, Theorien und Methoden verschiedener Disziplinen aufeinander zu beziehen, zu reflektieren und in Austausch zu bringen.
Die interdisziplinäre Kompetenz der Hochschule Luzern in diesen Bereichen liess sich durch den ITC entscheidend fördern. Die Fachpersonen arbeiten eng mit der Praxis zusammen und sind national wie international gut vernetzt. Der Themencluster generiert innovative Lösungen, um die Herausforderungen des gesellschaftlichen Wandels zu meistern. Das entsprechende Aus- und Weiterbildungsangebot wird kontinuierlich weiterentwickelt.
Im Rahmen des Themenclusters werden fünf Fokusthemen bearbeitet.
Fokusthemen
- Baukultur in der Gemeinde-, Stadt- & Regionalentwicklung
- Energiewende & Sozialraum
- Wohnen & Nachhaltigkeit
- Kulturelle Teilhabe & Öffentlichkeiten
- Smarte Soziale Infrastrukturen
Baukultur in der Gemeinde-, Stadt- & Regionalentwicklung
Das Fokusthema leistet einen Beitrag zur Verankerung einer qualitätsvollen Gestaltung unserer gebauten Lebensräume in der Praxis der Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung, indem adäquate Lösungen für die zahlreichen Zielkonflikte zwischen individuellen Bedürfnissen und öffentlichen Interessen bei baulichen Transformationsprozessen transdisziplinär erarbeitet werden. Hier mehr erfahren.
Energiewende & Sozialraum
Das Fokusthema unterstützt die Umsetzung der Energiestrategie 2050, indem sozialräumliche Aspekte als wesentliches Element zur Verwirklichung der Energiewende mit verschiedenen Stakeholdern eingebracht und mit der Umsetzung von technischen Lösungen gezielt verbunden werden. Hier mehr erfahren.
Wohnen & Nachhaltigkeit
Das Fokusthema hilft bei der Realisierung eines nachhaltigen Wohnungswesens und eines diversen Angebots an innovativen Wohnformen, indem Bedürfnisse und Trends analysiert, zeitgemässe Konzepte entwickelt und die notwendigen Grundlagen sowie Handlungsempfehlungen für öffentliche und private Entscheidungsträger:innen erarbeitet werden. Hier mehr erfahren.
Kulturelle Teilhabe & Öffentlichkeiten
Das Fokusthema trägt zur Hör- und Sichtbarmachung sowie Anerkennung kultureller Vielfalt, zu Debatten über Werthaltungen und zur Verbesserung des Zusammenlebens bei, indem soziokulturelle Praktiken und künstlerische Gestaltungsprozesse unter dem Aspekt gesellschaftlicher Partizipation entwickelt und erforscht werden. Hier mehr erfahren.
Smarte Soziale Infrastrukturen
Das Fokusthema fördert die Entwicklung von smarten Lösungen für bestehende und zukünftige Herausforderungen von sozialen Infrastrukturen in Gemeinden, den Kantonen und beim Bund im Spannungsfeld von Wandlungstreibern wie der Digitalisierung, des demographischen Wandels und der Individualisierung. Hier mehr erfahren.
Partnerschaften
Stiftung Baukultur Schweiz
Seit Anfang 2021 besteht eine Partnerschaft zwischen dem ITC Raum & Gesellschaft und der Stiftung Baukultur Schweiz. Insbesondere im Bereich der Forschung und Weiterbildung wird eine Kooperation angestrebt, die dem Ziel der Verankerung einer hohen Baukultur in der Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung dient. Stefan Kunz (Hochschule Luzern, ITC Raum & Gesellschaft) hat Einsitz im Beirat der Stiftung.
Network for Transdisciplinary Research (td-net) – Akademie der Wissenschaften Schweiz
Mit dem Network for Transdisciplinary Research (td-net) betreiben die Akademien der Wissenschaften Schweiz eine Drehscheibe zur Förderung von Transdisziplinarität in Forschung und Lehre in der Schweiz und weltweit. Die langjährige Co-Leiterin des ITC Ulrike Sturm wurde als erste Vertreterin einer Schweizer Fachhochschule in den Beirat des Network for Transdisciplinary Research gewählt.
Internationaler Arbeitskreis «Gender- and Climate-just Cities and Urban Regions» der Akademie für Raumentwicklung in der Leibnitz-Gemeinschaft
Der internationale Arbeitskreis der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft vernetzt Fachpersonen aus verschiedensten Disziplinen und Praxisfeldern, die sich aus einer gendersensiblen Planungsperspektive mit den Herausforderungen des Klimawandels beschäftigen, mit denen Städten und urbanen Gebieten konfrontiert sind. Geleitet wird der Arbeitskreis von der langjährigen Co-Leiterin des ITC Ulrike Sturm und Doris Damyanovic (Universität für Bodenkultur Wien).
Netzwerk GenderArchland – Netzwerk für GenderKompetenz in Architektur Landschaft Planung
Der ITC Raum & Gesellschaft beteiligt sich an der Forschungs- und Vernetzungsplattform «Genderkompetenz in Architektur, Landschaft und Planung – GenderArchland» welche eine genderorientierte räumliche Planung betreibt und sich dem Aufbau ebensolcher Kompetenzen in den verschiedenen mit der räumlichen Planung betrauten Disziplinen verschreibt. Zusammen mit der Fachhochschule Kiel, der Universität für Bodenkultur Wien und der Universität Lichtenstein ist der ITC Träger des Netzwerks. Ulrike Sturm ist Mitglied des Netzwerks und Mitherausgeberin der Publikation «Gendered Approaches to Spatial Development in Europe: Perspectives, Similarities, Differences»
Kernteam
Das ITC-Kernteam setzt sich aus Vertreter:innen der sechs Departemente der Hochschule Luzern zusammen. Sie begleiten die inhaltliche Weiterentwicklung des ITC und helfen bei der internen Vernetzung.
- Prof. Dr. Antonio Baldassarre, Leiter Forschung & Entwicklung sowie Vizedirektor, Departement Musik
- Prof. Dr. Ulrike Sturm, Leiterin Forschung & Entwicklung, Departement Soziale Arbeit
- Dr. Anna Amacher Hoppler, Dozentin und Projektleiterin, Departement Wirtschaft
- Prof. Stephan Käppeli, Dozent und Projektleiter, Departement Wirtschaft
- Marvin King, Senior wissenschaftlicher Mitarbeiter, Departement Technik & Architektur
- Prof. Urs-Peter Menti, Co-Institutsleiter Gebäudetechnik und Energie, Departement Technik & Architektur
- Prof. Dr. Rachel Mader, Leiterin CC Kunst, Design & Öffentlichkeit, Departement Design & Kunst
Fachbeirat
Der ITC-Fachbeirat ist bestückt mit externen Fachpersonen aus unterschiedlichen Bereichen der Raumentwicklung. Ihre Aufgabe ist es, die inhaltliche Entwicklung des ITC kritisch zu prüfen und bei der externen Vernetzung zu unterstützen.
- Dr. Anita Grams, SBB Unternehmensentwicklung, Expertin integrierte Mobilitäts- und Raumplanung
- Dr. Maria Lezzi, Direktorin des Bundesamts für Raumentwicklung ARE
- Dominik Matter, Partner bei Fahrländer Partner Raumentwicklung
- Prof. Dr. Herbert Schubert, Inhaber von Sozial • Raum • Management – Büro für Forschung und Beratung
- Samuel Summermatter, Experte Photovoltaik Engineering und Co-GL Plan-E AG
Ab 2024: IDN Raum & Gesellschaft
Auch in der aktuellen Strategieperiode der Hochschule Luzern geniesst das Ziel einer integralen Raumentwicklung zur Stärkung des Zusammenlebens und der Lebensqualität hohe Priorität. Der ITC wurde daher 2024 in das Interdisziplinäre Netzwerk (IDN) «Raum & Gesellschaft» überführt, um das bisher Erreichte für die Zukunft sicherzustellen und weiterzuentwickeln. Hier mehr erfahren.